Produktpasspolitik
In meiner beruflichen Rolle habe ich in einem kurzen Kommentar die Mitwirkungsmöglichkeiten rund um den „Digitalen Produktpass“ beschrieben:
Digitaler Produktpass: Europäische Industriepolitik ist mitgestaltbar.
Vom AI Act bis hin zum viel diskutierten Renaturierungsgesetz: die letzte Amtsperiode der europäischen Kommission war geprägt von einer Vielzahl an Regulierungen. Zähe Verhandlungen und hart errungene Kompromisse waren dabei ein ständiger Begleiter.
Ursula von der Leyen leitet nun für weitere fünf Jahre die EU-Kommission. Es ist trotz veränderter geopolitischer Lage davon auszugehen, dass die Ergebnisse der letzten fünf Jahre von der neuen alten Kommissionspräsidentin wohl nicht über Bord geworfen werden. Im Gegenteil: viele der beschlossenen Rechtsakte kommen demnächst erst zur Anwendung.
Für Österreichs wichtige produzierende Industrie sind z.B. das Datengesetz, die Lieferkettenrichtlinie oder die neue Ökodesignverordnung hochrelevant. Als Rechtsakte sind sie alle bereits in Kraft, konkrete Verpflichtungen für Unternehmen werden in den kommenden Jahren Schritt für Schritt erarbeitet und eingeführt. Sehr viel ist hier noch offen.
Ökodesignverordnung und Digitaler Produktpass
Beispielsweise zielt die neue Ökodesignverordnung (Ecodesign for Sustainable Products Regulation, ESPR) darauf ab, europäische Produkte nachhaltiger zu gestalten und die vielbeschworene Kreislaufwirtschaft in der Praxis umzusetzen. Batterien, Textilien, Baustoffe, etc. – unterschiedliche Produktkategorien sollen mit Hilfe der ESPR umweltfreundlicher werden. Über Jahre wurde verhandelt, am 18. Juli ist die ESPR in Kraft getreten. Ihre volle Gültigkeit entfaltet die Regelung jedoch erst in den nächsten Jahren.
Ein zentrales Element für die Umsetzung der ESPR wird der Digitale Produktpass (DPP) bilden. Mit dessen Hilfe sollen über den Lebenszyklus eines Produkts relevante Daten ausgetauscht werden, vom Hersteller bis zum Entsorgungsunternehmen. Im DPP verschiedener Produkte – eines Handyakkus, eines Pullovers, eines Kühlschranks etc. – sollen z.B. Informationen zu den verarbeiteten Materialien gespeichert werden und langfristig z.B. Reparatur- oder Recycling-Unternehmen die Verwertung der Bestandteile erleichtern. 2027 sind die ersten verpflichtenden Produktpässe geplant.
Um diese Zielsetzung einzuhalten, sind noch viele Schritte notwendig. Einerseits muss festgelegt werden, wie der Digitale Produktpass technisch umgesetzt wird. Chips, Barcodes oder Formate für die Datenspeicherung werden eine wichtige Rolle spielen. Mit diesen Themen beschäftigt sich derzeit die europäische Standardisierung bei CEN-CENELEC. Andererseits muss für die sehr verschiedenen Produktkategorien entschieden werden, welche Daten wie erfasst werden sollen. Bei Baustoffen sind andere Kriterien oder Speichermedien relevant als bei Elektrogeräten.
Spielraum bei Details, Mitwirkung erwünscht
Doch was ist die Grundlage für die Daten im DPP – wie kommen EU-Beamte zu Informationen?
Zum einen können Vertreterinnen aus Industrie, Wissenschaft oder Verbänden in branchenspezifischen Workshops ihre Wünsche, Bedenken und Überlegungen einbringen. Aktuell finden Workshops zu Eisen- und Stahl-Produkten sowie zu Textilien statt. Zum anderen wird in Kürze das so genannte Ökodesign Forum als Expertengruppe der Kommission aufgesetzt. Für dieses Ökodesign Forum können sich interessierte Personen bewerben, um die produktgruppenspezifischen Eigenheiten des DPP mitzugestalten.
Durch Interaktion mit der EU-Kommission können Unternehmen, wissenschaftliche Einrichtungen, NGOs etc. den DPP mitgestalten und sicherstellen, dass die Umsetzung möglichst praktikabel erfolgt. Es ist im Interesse der Politik, dass Regularien nicht als belastende Bürokratie empfunden werden. Im Gegenteil: im Optimalfall sollen Regularien wie die ESPR der europäischen Wirtschaft neue Chancen und Möglichkeiten bieten.
Europäische Regularien brechen nicht sintflutartig über die Wirtschaft herein. Österreichische Stakeholder können die europäische Industriepolitik mitgestalten, die Umsetzung der ESPR zeigt das beispielhaft. Kammern, Verbände und wissenschaftliche Einrichtungen bieten Unterstützung für interessierte Firmen. Diese müssen sich nur einbringen.
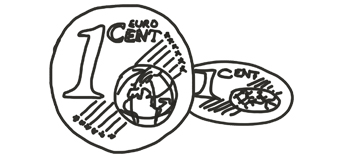

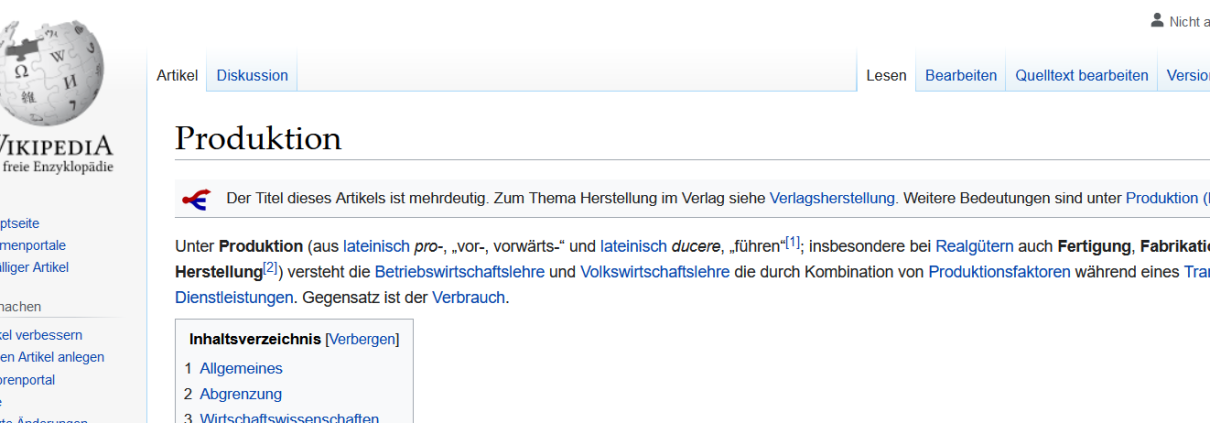
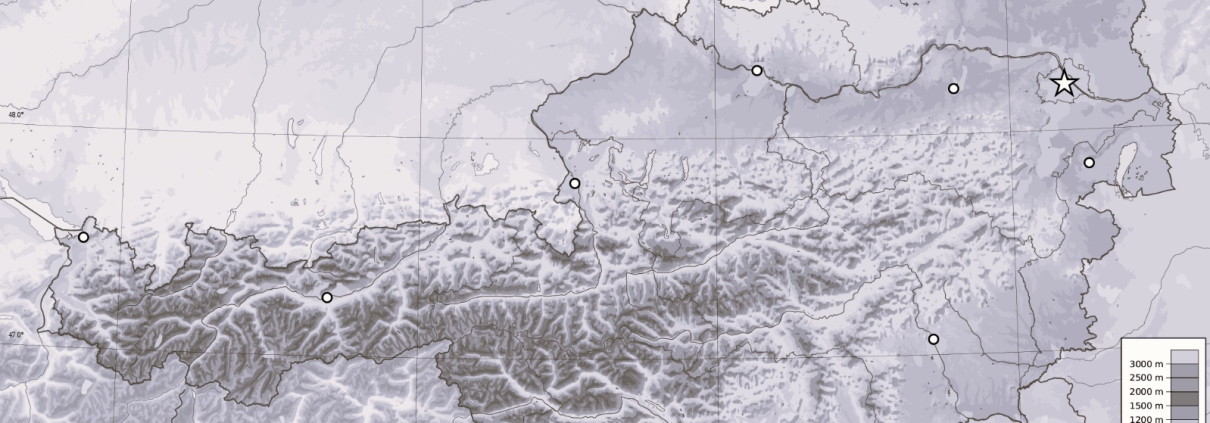
Neueste Kommentare